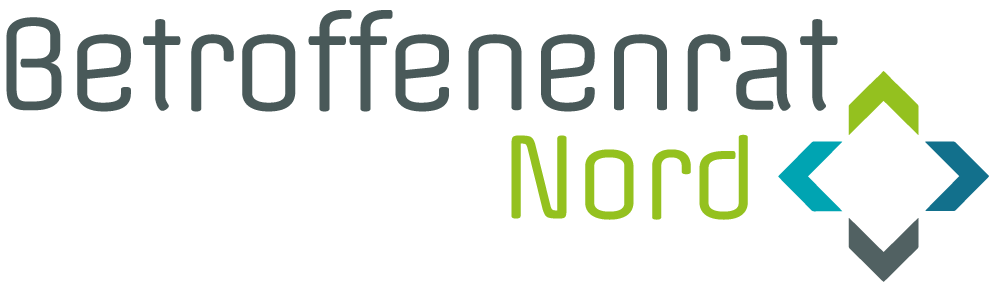„Die Ampel steht fast überall noch auf rot“ – so hatten wir im April 2023 unsere Pressemitteilung zur Veröffentlichung des ersten Ampelsystems, mithilfe dessen das Bistum Hildesheim die bisherige Umsetzung der Empfehlungen aus den verschiedenen externen Gutachten bewertet hatte, betitelt. Seit Herbst 2024 wurde die Umsetzung erneut geprüft und durch das Bistum und uns nun neu bewertet.
In einigen wichtigen Punkten ist die Ampel von rot auf grün gesprungen:
So verfügt das Bistum seit Januar 2025 endlich sowohl über eine Lotsenstelle als auch über eine Ombudsstelle für Betroffene. In deren Auswahl wurde der Betroffenenrat von Beginn an konsequent eingebunden. „Dass die Lotsenstelle über kein eigenes Budget verfügt und direkt an die Stabsabteilung angebunden ist, sehen wir kritisch und hätten das Osnabrücker Modell bevorzugt, aber insgesamt ist das Bistum hier auf einem sehr guten Weg“, lobt Norbert Thewes, einer der Sprecher des Betroffenenrats Nord. „Bei der finanziellen Unterstützung der Vernetzung von Betroffenen steht die Ampel klar auf grün. Als Rat haben wir einen eigenen Account für Videokonferenzen, Fahrtkosten für Begleitungen von Betroffenen usw. werden übernommen und auch die lokale Betroffeneninitiative Hildesheim wird vom Bistum bei ihren Aktivitäten finanziell unterstützt“, so Thewes weiter.
Bei anderen Punkten hat das Bistum den Fuß noch zu zaghaft auf oder noch über dem Gas:
Der Stellenwert der Betroffenenperspektive wird in der neuen Studie, die bisher jedoch noch nicht beauftragt wurde, verankert sein und tritt u.a. in dieser Ampelbewertung zutage, jedoch wurde die Sicht der Betroffenen bei den Entscheidungen sowohl über die Ansprechpersonen als auch über die Bischofsgruft ignoriert.
„Und im bischöflichen Beraterstab - dem Gremium, das über die Plausibilität von Meldungen und über Zahlungen berät - ist nach wie vor kein Betroffener vertreten“, moniert Raphael Ohlms, Co-Sprecher des Rats. „Dafür sitzen der Bischof selbst und auch sein Generalvikar mit all´ ihrer Amtsmacht im eigenen Beratungsgremium. Ob das zur empfohlenen „kritischen Grundhaltung“ der Beteiligten wirklich beiträgt? Hier muss die Betroffenenperspektive dringend berücksichtigt werden“, führt Ohlms weiter aus. Hier steht die Ampel aus unserer Sicht auf gelb bzw. rot, nicht auf grün. Ebenso auf rot steht der Punkt „Veröffentlichung“: Dass das Bistum bis vor Kurzem die eigene Interventionsordnung offensichtlich nicht kannte, erstaunt – Veröffentlichungen oder auch nur die Information der betroffenen Gemeinden über Täter finden nach wie vor bistumsseits nicht statt. Die einzige prominente Ausnahme ist hier Bischof Heinrich Maria Janssen; in anderen Fällen, in denen die Nennung rechtlich möglich wäre und Betroffene nachdrücklich darum bitten, geschieht dies nicht.
„Dass die Bistumsleitung sich selbst eine meldefreundliche Organisationskultur attestiert, wir aber von Mitarbeitenden verschiedener Berufsgruppen wiederholt ein „Klima der Angst“ und eine „Nest-beschmutzer-Mentalität“ geschildert bekamen, wirft die Frage nach der Kluft zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit auf“, so Ilona Düing aus Osnabrück, die das Sprecherteam komplettiert und im Jahr 2024 bei einer großen Videokonferenz mit Mitarbeitenden des Bistums ihre Außenwahrnehmung beisteuerte.
Etliche Punkte können von uns mangels Zugangs zu entsprechenden Informationen oder aufgrund von mangelnder Einbeziehung des Betroffenenrats Nord nicht beurteilt werden.
Insgesamt lassen sich klare Fortschritte bei der Umsetzung einzelner Empfehlungen feststellen – die Ampel ist von rot zumindest auf gelb, im Fall von Ombuds- und Lotsenstelle sogar auf grün gesprungen. Bei anderen liegen die Einschätzungen z.T. deutlich auseinander.
Dass sich das Bistum statistisch von 46-mal „Rot“ (Stand 04/23) auf zehnmal „Rot“ runterrechnen kann, liegt in fast der Hälfte der Punkte jedoch nicht am Vorankommen in der Sache, sondern im Erweitern des Farbspektrums auf fünf Farben: „Rot Spezial“ (6x) und vor allem „Grau“ (15x!).
Empfehlungen als „übergeordnete Forschungsdesiderate“ zu deklarieren, deren Umsetzung nicht in eigener Verantwortung liege, oder sie gänzlich an die Deutsche Bischofskonferenz oder gar die Weltkirche zu delegieren und sich damit selbst der Verantwortung zu entledigen, verkennt, dass das Bistum selbst Studien in Auftrag geben kann und selbst Teil der Bischofskonferenz und der Weltkirche ist.
Für Betroffene wichtige Empfehlungen wie die Evaluation und die Vereinfachung des Verfahrens zur Anerkennung des Leids, ein Abkommen zur Akteneinsicht oder Bedingungen zur Information der Öffentlichkeit stehen nun außerhalb der Bewertung, ggf. damit auch außerhalb der Sicht.
Verantwortung aber fängt vor Ort an, Handeln auch. Ziel muss auch hier ein Umspringen der Empfehlungen auf grün sein – nicht ihre Umetikettierung auf grau.